Oh je, da hab ich ja was losgetreten mit der elektrischen Wassertheorie...
Ich freu mich, dass zumindest
@AirHead was draus entnehmen konnte, der AHA-Effekt geht in die richtige Richtung!
Für alle die, die die Wassertheorie abgelehnt haben, eine zwar grobe, aber rein
elektrische Modellierung des Zündkreises, die ich mir mal eben ausgedacht habe.
Die elektrischen Parameter wurden - soweit sie in den Schaltungen eingetragen
sind - an der 6-V-Zündanlage der ES150 gemessen, sollten also mit nicht besser
als +/- 20 % Fehler akzeptiert werden.
Dateianhang:
Z01.JPG
Einige Vorgänge hat kutt weiter oben schon richtig beschrieben, ich wiederhole teilweise,
um den Zusammenhang zu wahren.
Der Zündkontakt ist geschlossen, durch den Primärteil der Zündspule baut sich während
weniger Millisekunden (Zeitkonstante= 4mH / 1,5 Ohm) ein Strom auf, der maximal
6V / 1,5 Ohm = 4 A erreichen kann.
Öffnet der Kontakt, so fließt der Strom kontinuierlich weiter (Gesetz: Durch eine
Iduktivität kann sich der Strom nicht sprunghaft ändern!) in den Zündkondensator hinein
und lädt ihn mit ungefähr dU/dt = 4 A / 0,22uF = 20 V/ us auf. D.h. nach 5 us haben wir
etwa 100 V am Zündkondensator anliegen.
Dieser positive Spannungssprung auf 100 V wird wie in einem Trafo von der Primärspule auf
die Sekundärspule mit einem Übersetzungsverhältnis von (grob!!!) 50 vervielfacht, gibt
also etwa 5 kV an der "inneren" Sekundärinduktivität von 22 H.
Dadurch, dass der Mittelpunkt des sogenannten Spartrafos an Klemme (15) spannungsmäßig konstant
gehalten wird, erscheinen die 5 kV als negative Spannung am Ende der Sekundärspule.
Die Polarität hat aber für den Zündvorgang keinerlei Bedeutung, sie erklärt nur, warum
in dem folgenden Oszillogramm der gemessene etwa 5kV große Impuls auf dem Zündkabel nach unten
gerichtet ist.
[@kutt: Ätsch, kutt, habbsch schon lange mal oszillografiert....)
Dateianhang:
Z02.JPG
Was ist aber mit dem inneren Widerstand von 7,5 kOhm? Der bildet für die Aufladung
der Zündleitung mit der Kabelkapazität + Kerzensteckerkapazität ein RC-Glied, das eine
Zeitkonstante von größenordnungsmäßig 0,5 us aufweist (7,5 kOhm * ca. 50 pF).
Damit greift die oben berechnete Spannungsanstiegsgeschwindikeit von ca. 1 kV/us noch
voll auf das Zündkabel und noch weiter über den Entstörwiderstand von 5 kOhm zu den
Kerzenelektroden durch.
Die Elektrodenkapazität der Zündkerze ist schätzungsweise 1pF oder kleiner, d.h.
die Elektroden-Aufladezeitkonstante ist nur 5ns und damit wahnsinnig klein, kann also mühelos
dem Spannungsanstieg folgen. Dies ist übrigens die Begründung dafür, weswegen es nahezu
gleichgültig ist, ob der Entstörwiderstand 5kOhm, 10kOhm oder Null kOhm ist, die Elektrodenkapazität
wird immer gleich schnell aufgeladen ... bis es ... ja bis es nun endlich bei 7... 10 kV
zum Überschlag kommt.
In diesem Moment fließt ein Strom von etwa 100 A durch den Funken,
die Elektrodenspannung bricht innerhalb weniger Nanosekunden auf vielleicht 100 V
zusammen und es kommt anschließend zur Lichtbogenentladung.
Da die Elektrodenkapazität ihr Pulver verschossen hat, kann der Stromnachschub
jetzt nur noch über den Entstörwiderstand + Innenwiderstand der Sekundärspule kommen.
Deshalb ist dieser Strom auch deutlich geringer (<1A) und die Bogenentladung (1 us) geht
schließlich in eine sogenannte Glimmentladung (ca. 1ms) über bis sie schließlich verlischt.
(die Zeitangaben für die verschiedenen Gasentladungsarten an der Kerze stammen aus der Literatur)
Über die Leistungsbilanzen kann man nun streiten, weils bisher keiner so recht gemessen hat.
Bestenfalls halbe / halbe für die erste Durchbruchsentladung und die anschließende Bogen+Glimmentladung,
liest man als vage Angaben in der Literatur. Dazu kommt, dass die elektrische Leistung als solche
noch nichts über die Eigenschaften der Gemischentflammung aussagt. Da ist wohl auch noch
Forschungsbedarf...
Und nun kommt die Vorfunkenstrecke dazu:
Dateianhang:
Z03.JPG
Baut man die jetzt so, dass sich darüber erst eine viel größere Spannung aufbauen muss,
bis es dort zum Durchschlag kommt (größerer Abstand der Vorfunkenstreckenelektroden),
wird das Zündkabel demzufolge auf die vielleicht drei- bis fünffache Spannung aufgeladen
bis es einen Durchschlag auf der Vorfunkenstrecke gibt. Der Durchschlag wirkt wie ein
plötzlich geschlossener Schalter. Der Schalter legt jetzt also die um ein Vielfaches
aufgeladene Zündkabelkapazität an den Kerzensteckereingang. Und jetzt schlussfolgere ich mal,
dass damit die Bogenentladungsphase der Kerze länger und kräftiger "gefüttert" werden kann.
Der Einbau der Vorfunkenstrecke in ein funktionierendes Zündsystem ist jedoch Humbug.
Wer´s nicht glaubt, der soll seine 6-V-Zündung mal probewesie mit 12V betreiben
(für kurze Zeit geht das) und dann hier berichten, wieviel gefühlte PS aufgrund des
kräftigeren Funkens zusätzlich anlagen....
Gruß
Lothar,
der mit dieser zu lang geratenen Abhandlung anstatt eines Spazierganges
den Festtagsbraten perfekt verdaut hat.
@telefoner: Wie kutt schon schrieb, ist das Zündsystem in seinen primären Effekten als
diskretes System aufzufassen - also nicht als Wellenleiter mit verteilten Parametern.
Klar machen kann man sich das in der Tat anhand der zeitlichen Größenordnungen der
wesentlichen Prozesse und der Ausbreitungsgeschwindigkeit im System. Nur mal so zum Beispiel:
Eine Schwingung mit einer Mikrosekunde Periode hätte eine Wellenlänge von ca. 300m.
Selbst wenn man noch höhere Frequenzanteile ins Kalkül zieht, bleibt unsere Zündanlage
in den räumlichen Abmessungen klein gegen 30m oder 3m. Also ist es in erster Näherung richtig,
mit konzentrierten Ersatzelementen R, L, C zu arbeiten. Anpassung und Reflektionen und
solche Dinge spielen hier also keine primäre Rolle.





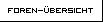










 Ach ja: Ich hab hier noch was rumliegen, Sosa? Braucht nicht behandelt werden, man sieht eh nur die Kugel und da kommt die Klemmfaust druff.
Ach ja: Ich hab hier noch was rumliegen, Sosa? Braucht nicht behandelt werden, man sieht eh nur die Kugel und da kommt die Klemmfaust druff.